
MedAT-Aufgaben 2024
20.000 Aufgaben für BMS, TV, KFF und SEK - stets aktuell, innovativ und effizient.
MedAT-Aufgaben 2024
Probleme bei der Anmeldung oder Bezahlung? Melde dich gerne per Mail bei uns:
support@get-to-med.com
Kurs Inhalt
Alle aufklappen
Lektion Inhalt
0% Beendet
0/9 Schritte
Lektion Inhalt
0% Beendet
0/13 Schritte
Lektion Inhalt
0% Beendet
0/7 Schritte
Lektion Inhalt
0% Beendet
0/6 Schritte
Textverständnis
9 Quizze
Ausklappen
Lektion Inhalt
KFF: Gedächtnis und Merkfähigkeit
3 Quizze
Ausklappen
KFF: Zahlenfolgen
4 Quizze
Ausklappen
KFF: Implikationen erkennen
1 Quiz
Ausklappen
SEK: Emotionen erkennen
3 Quizze
Ausklappen
SEK: Emotionen regulieren
2 Quizze
Ausklappen
SEK: Soziales Entscheiden
2 Quizze
Ausklappen
Simulationen
4 Themen
|
20 Quizze
Ausklappen
Lektion Inhalt
0% Beendet
0/4 Schritte
Preview this Kurs
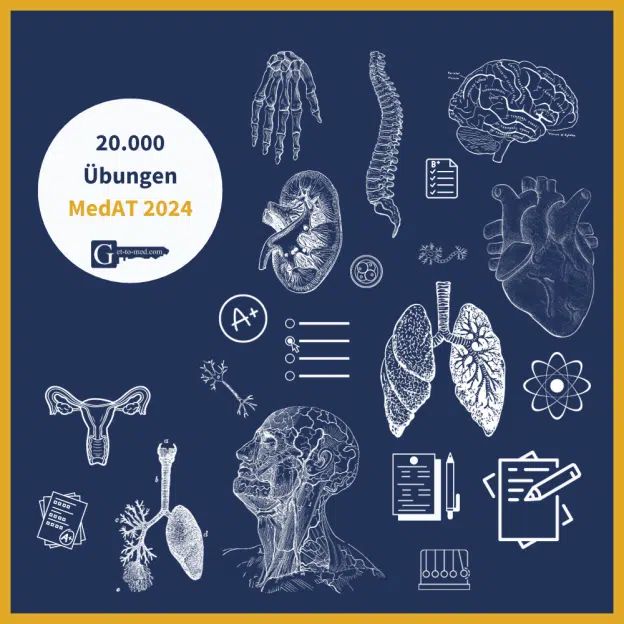

Anmelden
Für den Zugriff auf diesen kurs ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte gib deine Anmeldedaten unten ein!

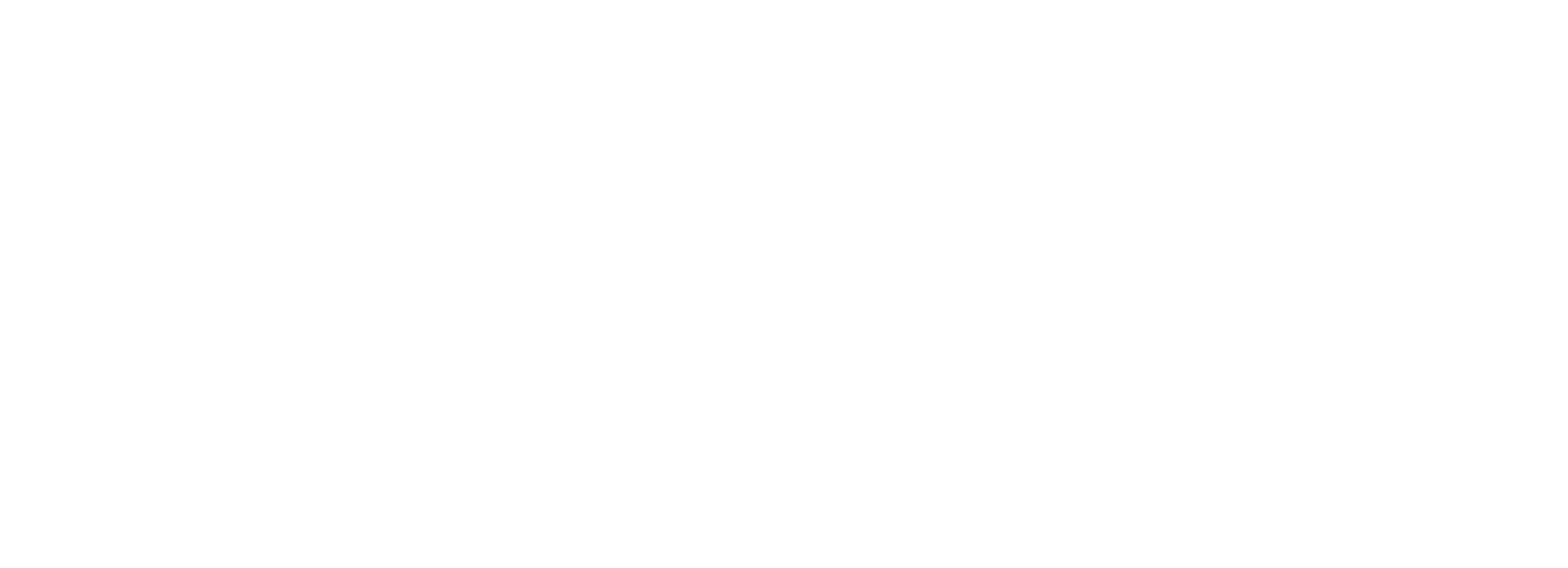
Antworten